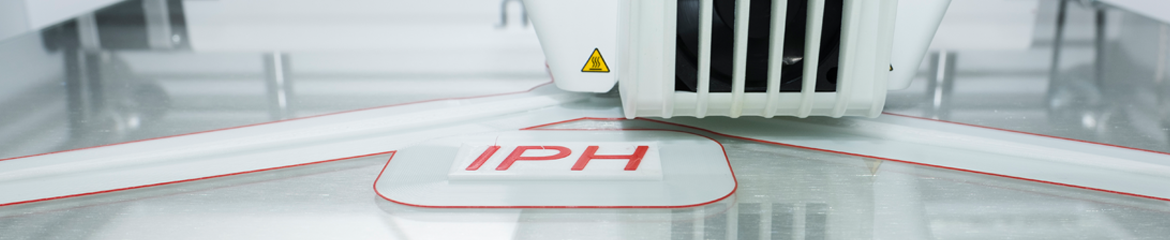- Grundlagen der additiven Fertigung
- Einsatzgebiete und Vorteile der additiven Fertigungsverfahren
- Potenziale der generativen Fertigung
- Implementierung und Kosten von 3D-Fertigung
Grundlagen der additiven Fertigung
Additive Fertigung, die üblicherweise auch als 3D-Fertigung oder generative Fertigung bezeichnet wird, gewinnt in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Insbesondere im Prototypenbau, bei Bauteilen mit hohem Individualisierungsgrad oder Bauteilen mit einer komplizierten Geometrie finden diese Fertigungsverfahren Anwendung. Doch auch in der Fertigung von Endprodukten wächst der Umfang, in welchem additive Fertigung angewendet wird.
Bei additiven Fertigungsverfahren wird durch Zufügen von Material ein Bauteil erzeugt. Eine Besonderheit der generativen Fertigungsverfahren ist, dass der Fertigungsprozess werkzeuglos und ohne Formen direkt auf Grundlage von 3D-CAD-Daten erfolgt. Dies erhöht gegenüber der herkömmlichen Fertigungsverfahren die Flexibilität in der Fertigung. Mit verschiedenen additiven Fertigungsverfahren können unterschiedliche Werkstoffe verarbeitet werden – wie etwa Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken und Metalle.
Wie funktioniert additive Fertigung? Bei der Additiven Fertigung wird ein Bauteil anhand einer 3D-CAD-Datei erzeugt. Es gibt Verfahren, bei denen das zu erzeugende Bauteil direkt in allen drei Raumrichtungen gefertigt wird. In der Regel erfolgt die Fertigung jedoch schichtweise, indem zunächst eine Ebene des Bauteils gefertigt wird. Über das Hinzufügen weiterer Schichten in der dritten Raumrichtung entsteht das dreidimensionale Bauteil. Durch Aufschmelzen oder chemische Aushärteprozesse wird ein Stoffzusammenhalt geschaffen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.
Einsatzgebiete und Vorteile der additiven Fertigungsverfahren
Generative Fertigungsverfahren finden insbesondere in Bereichen Anwendung, in denen geringe Stückzahlen, eine komplizierte Geometrie und ein hoher Individualisierungsgrad gefordert sind. Dies ist im Werkzeugbau, in der Luft- und Raumfahrt oder bei medizinischen Produkten der Fall. In der Luftfahrt können beispielsweise durch innenliegende Strukturen Gewichtsreduktionen erreicht werden. Für diese Bereiche bieten generative Fertigungsverfahren einige Vorteile, wie die Werkzeuglose und formlose Fertigung, die Möglichkeit der Erzeugung komplizierter Geometrien, eine flexible Produktion, die Möglichkeit sehr kleine Strukturen zu fertigen, Potentiale Material einzusparen und Gewicht zu reduzieren. Insgesamt bieten die generativen Fertigungsverfahren auch Chancen für die Automatisierung der Produktion. Allerdings haben additive Fertigungsverfahren auch einige Nachteile. Dies sind zum einen notwendige Nachbearbeitungsschritte, wenn eine hohe Oberflächengüte oder die Einhaltung von Toleranzen gefordert ist, zum anderen lange Prozesszeiten, da das Bauteil meist Schicht für Schicht erzeugt wird.
Die generativen Fertigungsverfahren sind nicht für alle Anwendungen gleichermaßen geeignet. Im Bereich der standardisierten Massenproduktion sind konventionelle Fertigungsverfahren der additiven Fertigung vorzuziehen. Wenn bei Bauteilen Toleranzen eingehalten werden müssen oder eine bestimmte Oberflächengüte erreicht werden muss, ist bei den 3D-Fertigungsverfahren in der Regel eine Nachbearbeitung notwendig.
Es gibt verschiedene generative Fertigungsverfahren wie etwa Stereolithografie, Laserstrahlschmelzen, Lasersintern, Elektronenstrahlschmelzen, Fused Layer Modelling und Digital Light Processing, die unterschiedliche Werkstoffe verarbeiten können und die somit auch für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.

Anwendung additiver Fertigungsverfahren bei Verarbeitung von Werkstoffen
Potenziale der generativen Fertigung
Die besonderen Vorzüge der 3D-Fertigung liegen darin, dass anders als bei den konventionellen Fertigungsverfahren die Fertigung ohne Werkzeug und ohne Form erfolgt. Die gewünschte Geometrie wird direkt aus 3D-CAD-Daten erzeugt. Dies ermöglicht eine schnelle Fertigung von Prototypen (rapid prototyping), von Endprodukten (rapid manufacturing) und von Werkzeugen und Formen (rapid tooling) und erhöht die Flexibilität in der Produktion.
Des Weiteren ist es möglich verschiedene Bauteile auf einer Maschine zu fertigen – unter Umständen sogar zeitgleich. Da die Fertigung werkzeuglos erfolgt, können die zu fertigenden Teile ohne Aufwand individualisiert werden.
Die additiven Fertigungsverfahren finden insbesondere in der Luft- und Raumfahrt, dem medizinischen Bereich (Prothetik), der Automobilbranche und dem Werkzeugbau Anwendung, da in diesen Branchen Anforderungen an die Bauteile gestellt werden, welche die generative Fertigung begünstigen. Durch 3D-Fertigungsverfahren können Geometrien erzeugt werden, die mit konventionellen Fertigungsverfahren nicht oder nur mit hohem Aufwand erzeugt werden können. Diese sind abhängig vom gewählten additiven Fertigungsverfahren – beispielsweise innen liegende und konturnahe Kühlkanäle, Hinterschnitte, innen liegende Strukturen, unterschiedliche Wandstärken, Freiformflächen oder Strukturen in sehr kleinen Größen.
Ein weiterer Vorteil der additiven Fertigung ist, dass der Fertigungsprozess automatisiert abläuft. Für den Fertigungsprozess ist es nicht erforderlich, dass ein Mitarbeiter die Maschine bedient. Nur das Vorbereiten der Maschine und das Entnehmen des Bauteils, sowie eine mögliche Nachbehandlung, muss manuell erfolgen.
Implementierung und Kosten von 3D-Fertigung
Je nachdem, welches additive Fertigungsverfahren angewendet werden soll, existieren große Preisunterschiede zwischen den Anlagen für das jeweilige additive Fertigungsverfahren. So liegen die Kosten für einen industrietauglichen FLM-Drucker (Fused Layer Modeling-Drucker) im Bereich von 15.000 €, wohingegen eine Lasersinter- oder Laserschmelzanlage mehr als 100.000 € kostet. Je nach Größe des Bauraums kann eine solche Anlage auch noch deutlich teurer sein.
Um die richtige Anlage auszuwählen, ist es deshalb wichtig zu wissen, für welche Anwendung die 3D-Fertigung eingesetzt werden soll. Auch sollte beachtet werden, welche laufenden Kosten beim Betreiben einer generativen Fertigungsanlage entstehen. Da die additive Fertigung nicht für alle Bauteile gleichermaßen geeignet ist, ist auch die Auswahl von Bauteilen, die generativ gefertigt werden können, ein Aspekt, dem besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden muss. Wenn die Anschaffung einer eigenen Fertigungsanlage für additive Fertigung nicht lohnenswert ist, können Bauteile auch bei Dienstleistern (3D-Druckshops) gefertigt werden.
Bei der Auswahl von geeigneten Verfahren, Lösungen und geeigneten Bauteilen kann das IPH unterstützen, das verschiedene Dienstleistungen im Bereich der generativen Fertigung anbietet. Durch umfangreiche externe Expertise kann somit eine optimale Beratung für die Auswahl und Umsetzung von additiven Fertigungsverfahren beziehungsweise 3D-Lösungen gewährleistet werden. Ein unabhängiger Anbieter wie das IPH kann beim Bewerten, Auswählen, Optimieren und Umsetzen von Technologien der additiven Fertigung helfen.
Darüber hinaus kann das IPH als Dienstleister auch bei der Bewertung und Optimierung von schon bestehenden generativen Fertigungsverfahren seine Unterstützung geben und umfassend beraten. Das Angebot des IPH im Bereich der 3D-Fertigung beruht auf dem aktuellsten Know-how aus Forschung und Technologieentwicklung.
Hier können Sie sich über unsere weiteren Dienstleistungen im Bereich der Fertigung informieren.